Prävention und Sicherheit
FAQ zum Thema Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball

FAQ Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball
Die Anzahl der Gewaltvorfälle auf und neben den Platz bewegt sich im Promillebereich, doch immer wieder schockieren einzelne Fälle den gesamten Fußball in Deutschland. Nur mit Mitgefühl für die Geschädigten und dem sachlichen Blick auf Ursachen und Lösungswege vermag der Fußball seiner Verantwortung gerecht zu werden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu "Gewalt und Diskriminierung im Amateurfußball".
Wenn mir etwas widerfährt, ob beim Spiel, beim Training oder im Verein, wohin kann ich mich wenden?
Alle Landesverbände haben unter dem Dach des DFB eine Anlaufstelle für Gewalt- und Diskriminierungsfälle eingerichtet. Die Ansprechpersonen werden kontinuierlich geschult und begleitet, um Betroffenen von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen Unterstützung anbieten zu können. Hier finden sich die Ansprechpersonen und Kontaktdaten (LINK ergänzen). Mit Hilfe des vom Bundesinnenministerium geförderten Pilotprojekts "Fußball Verein(t) Gegen Rassismus" wurde zuletzt die Vernetzung und der Ausbau der Anlaufstellen für Gewalt- und Diskriminierungsvorfälle in den Landesverbänden des DFB im und durch den Fußball intensiviert.
Wie oft kommt es auf den Plätzen zu Vorfällen von Gewalt und Diskriminierung?
Seit 2014 lässt der DFB auf Basis der Online-Spielberichte der Unparteiischen ein Lagebild des Amateurfußballs erheben. Rund 1,5 Millionen Fußballspiele werden pro Jahr in Deutschland unter Organisation der Verbände ausgetragen. In der Saison 2023/2024 wurden vier Prozent mehr Spiele als noch in der Saison zuvor ausgetragen. Gleichzeitig sank die Anzahl der Spielabbrüche um 5,5 Prozent. Die addierte Anzahl von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen ist sogar um 6,3 Prozent rückläufig – ein Trend, der Mut macht. Trotz mehr ausgetragenen Spielen lagen auch die absoluten Zahlen bei Spielabbrüchen, Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen unter dem Vorjahr.
Was tut der DFB für die Gewaltprävention auf dem Fußballplatz?
Zur Saison 2024/2025 sind im Amateurbereich nach regionalen Testphasen bundesweit einheitliche "Beruhigungspausen" eingeführt worden. Das so genannte DFB-STOPP-Konzept ist der wichtigste Teil eines Pakets, das die Verbände zur Gewaltprävention verabschiedet haben. Die Spielunterbrechungen können von den Schiris eingesetzt werden, wenn sich die Gemüter auf dem Platz zu sehr erhitzen. Darüber hinaus hat der deutsche Fußball nach der EURO 2024 die Kapitänsregelung übernommen. Heißt: Nur der Teamkapitän darf sich auf dem Spielfeld an den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin wenden, um eine wichtige Entscheidung erklärt zu bekommen. Auch diese Maßnahme soll zu mehr Besonnenheit und einem faireren Umgang beitragen.
Wie ist der DFB mit Blick auf Gewaltprävention konzeptionell aufgestellt?
Um Gewalt vorzubeugen und bei akuten Vorfällen schnell und angemessen reagieren zu können, hat der DFB 2014 das Gewaltpräventionskonzept "Fair ist mehr" entwickelt und in den Strukturen verankert, 2023 ist das Konzept nochmals aktualisiert worden. Unter Leitung des 1. DFB-Vizepräsidenten Ronny Zimmermann trifft sich regelmäßig die AG Gewaltprävention.
Wie fördern der DFB und die Landesverbände das faire Spiel?
Um die Wichtigkeit des fairen Umgangs zu betonen, veranstalten der DFB und die Landesverbände regelmäßig Fair Play-Tage, bei denen verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Vermittlung von fairem Verhalten im Kinder- und Jugendfußball, beispielsweise durch die Kampagne "Fair bleiben, liebe Eltern!". Bereits seit 1997 verleiht der DFB jährlich die "Fair Play-Medaille" und zeichnet damit besonders faire Spieler*innen, Mannschaften und Funktionär*innen aus. Neben den Amateuren wird jährlich auch eine Person aus dem Profibereich ausgezeichnet. Miroslav Klose, Jupp Heynckes und Niko Kovac zählten unter anderem zu den Ausgezeichneten der vergangenen Jahre.
Was geschieht, um auch Spieler*innen für den anspruchsvollen Job der Schiris zu werben?
2023 setzten der DFB und die Landesverbände im „Jahr der Schiris“ zahlreiche Aktivitäten um, die einen Beitrag zum Perspektivwechsel leisten sollten. Beispiele waren der Einsatz der Bundesliga-Profis Nils Petersen und Anton Stach als Schiedsrichter einer Bezirksligapartie, die TV-Dokumentation "Unparteiisch" oder der Einsatz der sogenannten "RefCam" in der Bundesliga und 3. Liga. Diese Perspektivwechsel sollten das gegenseitige Verständnis erhöhen, für die Herausforderungen der Schiedsrichterei sensibilisieren und gleichzeitig die faszinierenden Facetten dieser Aufgabe vermitteln. Das Ergebnis aus dem Jahr der Schiris war positiv. Erstmals seit mehr als 20 Jahren haben wieder mehr Menschen in einer Saison mit der Schiedsrichterei angefangen als aufgehört. Die Zahl der aktiven Schiris stieg um 8 Prozent, bei den Frauen sogar um 15 Prozent. Die Quote derjenigen, die mit dem Pfeifen aufhörten, sank um 20 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Jahr. 22 Prozent mehr Personen schlossen erfolgreich einen Schiri-Neulingslehrgang ab.
Wie zeichnet der DFB sonst noch vorbildliches Engagement und Handeln im und mit den Mitteln des Fußballs aus?
Der DFB und seine Landesverbände veranstalten zahlreiche Ehrungen. Mit dem Blick auf Gewalt und Diskriminierung und deren Prävention hat der Julius Hirsch Preis als Ehrung vorbildlichen Engagements herausragende Bedeutung. Einige der engagiertesten Schiedsrichter*innen des Jahres werden bei der Gala "Danke, Schiri" geehrt. Jährlich wird beim DFB-Ehrenamtspreis durch den "Club 100" und die Aktion "Fußballhelden" für das junge Ehrenamt herausragendes Engagement ausgezeichnet.
Welche weiteren präventiven Maßnahmen wären noch zu nennen?
Katrin Rafalski und Deniz Aytekin, also die Schiedsrichterin und der Schiedsrichter des Jahres 2022, haben an einem Schulungsvideo mitgewirkt, das in der Schiri-Qualifizierung genutzt wird. Was kann ich tun, wenn es auf dem Platz zu einem Gewalt- oder Diskriminierungsvorfall kommt, ist das Thema des siebenminütigen Lehrfilms.
Im Kampf gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung hat der DFB eine Broschüre zum Erkennen von Zeichen und Symbolen veröffentlicht.
"Anstoß für ein neues Leben" heißt die bundesweit einzigartige Initiative der Sepp-Herberger-Stiftung zur Resozialisierung jugendlicher Strafgefangener. Im Jahr 2019 wurde die Resozialisierungsinitiative von der UEFA als bestes Breitenfußballprojekt ausgezeichnet.
Kategorien: Prävention und Sicherheit, Fairplay, Vielfalt und Anti-Diskriminierung, Über uns
Autor: dfb
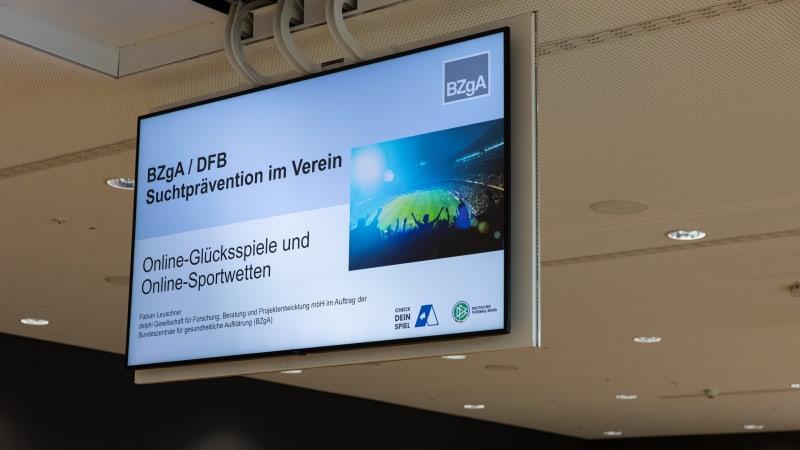
FAQ Sportwetten – Was Fans wissen sollten
Fußball und Sportwetten - das gehört für nicht wenige Fans zusammen. Warum sind Sportwetten so beliebt? Welche Präventionsmöglichkeiten gibt es? DFB.de beantwortet diese und weitere Fragen zu einem sehr sensiblen Thema.

80 Jahre Tag der Befreiung: Erinnerungsarbeit des DFB
Heute vor 80 Jahren endete der 2. Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands. Die kritische Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit ist heute mehr denn je Teil des Wirkens des DFB - auch durch den Julius Hirsch Preis. Zur Erinnerungsarbeit des DFB.

Der DFB, seine Funktionäre und der Nationalsozialismus
Heute vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg mit der Kapitulation Deutschlands. Der Historiker Pascal Trees hat für die DFB-Kulturstiftung die Rolle der DFB-Funktionäre während und nach der NS-Zeit aufgearbeitet. Hier gibt's den DFB-Journaltext.